Depression
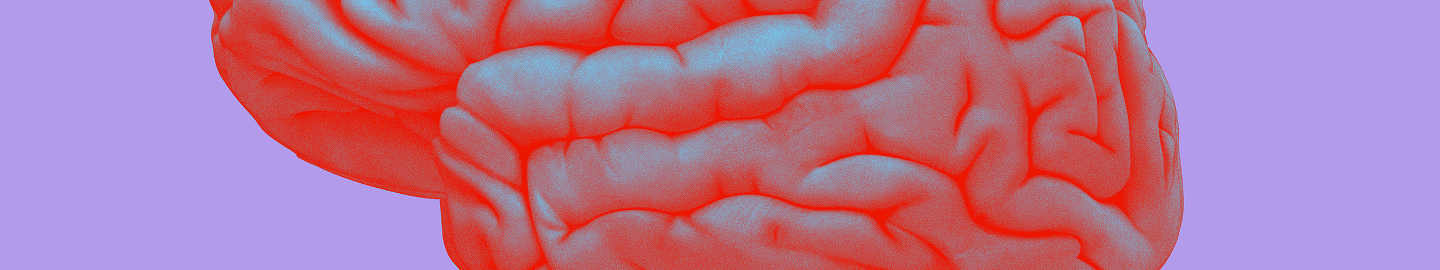
Depressionen zählen zu den häufigsten, aber auch meistunterschätzten Erkrankungen bezogen auf ihre Bedeutung für den Einzelnen und die Gesellschaft. Sie können in unterschiedlich schwerer Ausprägung auftreten. Die Erkrankung kommt in allen Kulturen annähernd gleich häufig vor und kann Menschen jeder sozialen Schicht treffen. Das Risiko, im Laufe des Lebens an einer Depression (alle Formen) zu erkranken, die sogenannte Lebenszeitprävalenz, liegt bei 16-20%.1

"Depression - die oftmals unsichtbare Volkskrankheit. Je intensiver man sich mit dieser Erkrankung auseinander setzt umso eher versteht man die vielschichtigen Auswirkungen mentaler Gesundheit auf die einzelnen Patient:innen und deren Umfeld.
Es ist mir ein persönliches Anliegen, Rahmenbedingungen für die Patient:innen mit Depression und deren Versorgung zu verbessern."
Raphaela Oswald, MSc.
Commercial Manager Dynamic Assets, J&J Innovative Medicine Austria
Die unipolare Depression ist die häufigste Form, bei der mindestens über zwei Wochen Anzeichen von Niedergeschlagenheit, Erschöpfung sowie Freud- und Antriebslosigkeit auftreten. Beschwerden wie Appetitlosigkeit und Schlafstörungen können hinzukommen.2
Eine bipolare Depression ist auch unter der Bezeichnung manisch-depressive Erkrankung bekannt. Menschen mit dieser Störung durchleben wechselnde Phasen extremer Stimmungsschwankungen: In der einen Phase zeigen sich die typischen Symptome einer Depression. In der anderen Phase schlägt die Stimmung ins Gegenteil um. Die Betroffenen sind dann plötzlich in Hochstimmung, sehr reizbar, extrem aktiv und selbstbewusst. Sie leiden unter Schlaf- und Konzentrationsstörungen. In diesen euphorischen Phasen verlieren viele Patienten den Bezug zur Wirklichkeit und können halluzinieren.2 Bei etwa einem Fünftel der Patienten, die an depressiven Episoden erkranken, treten bipolaren Störungen auf.1
Verlauf und Auswirkungen bei Depressionen
Wie verlaufen Depressionen?
Depressionen zeichnen sich typischerweise durch einen episodischen Verlauf aus. Die Krankheitsphase ist zeitlich begrenzt und kann auch ohne therapeutische Maßnahmen abklingen. Ist der Patient in der Folgezeit völlig symptomfrei, spricht man von einer vollständigen Remission. Bei einem sogenannten rezidivierenden Verlauf tritt eine erneute depressive Episode auf. Die meisten depressiven Episoden bilden sich, wenn sie entsprechend behandelt werden, innerhalb weniger Monate zurück. In 15 bis 20% der Fälle kann dies jedoch auch 12 Monate oder mehr dauern.3 Hält eine depressive Episode länger als zwei Jahre ohne Besserung in diesem Zeitraum an, spricht man von einer chronischen Depression.1
Wie ist die Prognose bei Depressionen?
Die Heilungschancen nach einer einzelnen depressiven Phase sind gut. Das Rückfallrisiko nach einer ersten Episode (bezogen auf die Lebenszeit) beträgt ohne Vorsorge etwa 50%, bei schweren Depressionen 75%. Ungünstig auf die Prognose wirken sich beispielsweise Alkohol- oder Drogenmissbrauch, Essstörungen, begleitende Angst- und Zwangsstörungen sowie chronische Verläufe aus. Wichtigster Faktor für das Rückfall- oder Wiedererkrankungsrisiko ist die Anzahl früherer Episoden. Unter einem Rückfall oder einer Wiedererkrankung (auch Rezidiv) versteht man das Wiederkehren von Krankheitsanzeichen nach zeitweiliger Besserung der Depression.3
Klinische, berufliche und private Folgen einer Depression
Betroffene mit einer Depression, die sich keiner Therapie unterziehen, können schnell in einen Teufelskreis geraten. Die Symptome einer depressiven Störung belasten Familie, Partnerschaft und Freundschaften. Zudem kann es zusätzlich zu Problemen am Arbeitsplatz kommen. Auch nach Abklingen der depressiven Symptome können diese sozialen Beeinträchtigungen bei vielen Patienten anhalten. Infolgedessen kann es zu Missbrauch von Alkohol, anderen Drogen oder Medikamenten kommen.4
Im schlimmsten Falle kann es bei einer Depression zu einer Selbsttötung kommen. 10 bis 15% der Patienten mit wiederkehrenden schweren depressiven Phasen sterben durch Suizid. Zu dem besonders gefährdeten Personenkreis gehören Patienten, die in belastenden psychosozialen Verhältnissen leben (etwa alleinstehend, geschieden oder drogenabhängig sind), außerdem Betroffene im fortgeschrittenen Alter (> 65 Jahren) und solche, die bereits Suizidversuche unternommen haben.4
Symptome und Diagnose einer Depression nach ICD-101
Die Hauptsymptome einer depressiven Verstimmung sind:
- eine gedrückte, traurige Stimmung
- Freud- und Interessenlosigkeit
- Antriebsschwäche mit erhöhter Müdigkeit (oftmals bereits nach kleinen Anstrengungen) und Einschränkung der Aktivität
Begleitend können folgende Zusatzsymptome auftreten:
- verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit
- geringes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen
- Gefühle von Schuld und Wertlosigkeit
- negative und pessimistische Zukunftsperspektive
- Suizidgedanken oder -handlungen, Selbstverletzungen
- Schlafstörungen
- verminderter Appetit
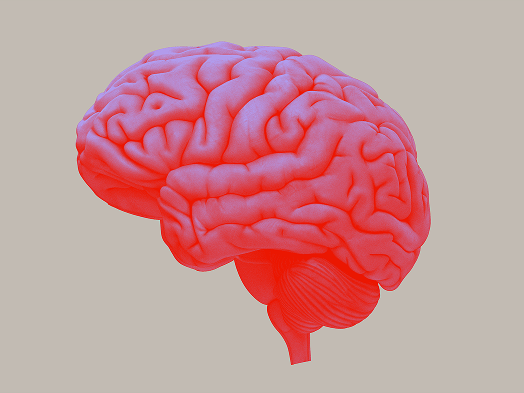
Unsere Produkte in den Neurowissenschaften
Depressionen können in unterschiedlichen Schweregraden auftreten. Diese werden folgendermaßen diagnostiziert:1
Leicht
zwei Hauptsymptome halten mindestens zwei Wochen an, zusätzlich treten zwei Zusatzsymptome auf
Mittelgradig
zwei Hauptsymptome bestehen mindestens zwei Wochen, zusätzlich werden drei bis vier Zusatzsymptome diagnostiziert.
Schwer
alle drei Hautsymptome treten mindestens zwei Wochen lang auf, außerdem leiden die Betroffenen unter mindestens vier Zusatzsymptomen.
Ursachen von Depressionen
Wie Depressionen entstehen, ist bisher im Detail nicht geklärt. Es ist individuell unterschiedlich, welche Rolle erbliche und umweltbedingte Faktoren spielen. Es wird davon ausgegangen, dass mehrere Faktoren zusammenwirken und sich daraus eine Depression entwickelt. Die Risikopersonen sind weniger tolerant gegenüber seelischen, körperlichen und biografischen Belastungen als gesunde Menschen. Diese besondere Sensibilität spielt bei dem Ausbruch einer Depression und ihrem Verlauf eine große Rolle.5
Faktoren, die das Auftreten von Depressionen begünstigen und ihren Verlauf beeinflussen, sind:5
Genetische Veranlagung
Eine genetische Vorbelastung (gehäuftes Auftreten von depressiven Erkrankungen innerhalb einer Familie) trägt nach dem heutigen Forschungsstand wesentlich zur Entstehung einer Depression bei. Sind Verwandte ersten Grades betroffen, liegt die Wahrscheinlichkeit, selbst zu erkranken, bei etwa 15%.5
Neurobiologische Störungen
Mit neurobiologischen Ursachen ist gemeint, dass im Gehirn das Gleichgewicht bestimmter Botenstoffe, den sogenannten Neurotransmittern, verändert ist. Diese Botenstoffe sind wichtig für die Übertragung von Nervenimpulsen und beeinflussen damit unter anderem unsere Stimmung und unser Verhalten. Prominente Vertreter der Neurotransmitter sind zum Beispiel Serotonin, Dopamin, Glutamat und y-Amino-Buttersäure (GABA). Depressive Patienten weisen im Vergleich zu Gesunden oft eine erniedrigte Aktivität dieser Substanzen auf, so dass die Weiterleitung von Nervenimpulsen gestört ist. Zusätzlich kann bei Betroffenen während einer depressiven Episode eine veränderte Aktivität des limbischen Systems im Gehirn auftreten. Dies lässt sich mittels bildgebender Verfahren feststellen. Das limbische System ist für eine stressregulierende Funktion sowie für das Empfinden und Verarbeiten von Gefühlen verantwortlich.5,6
Entwicklungs- und Persönlichkeitsfaktoren (psychosoziale Faktoren)
Zu den psychosozialen Faktoren werden belastende Erlebnisse wie der frühe Verlust eines Elternteils, Missbrauch, Vernachlässigung, eine gestörte Mutter-Kind-Beziehung oder Trennung gezählt. Weitere Risikofaktoren sind beispielsweise eine chronische Angststörung in der Kindheit und Jugend, begleitet von Unsicherheit und mangelndem Selbstvertrauen. Belastende Lebensumstände wie anhaltender Stress, Überforderung, wenig gesellschaftliche Kontakte oder Arbeitslosigkeit werden ebenfalls dazu gezählt. Durch stressreiche Lebensereignisse wird vermehrt das Stresshormon Cortisol ausgeschüttet, das auch bei Depression in erhöhter Konzentration im Blut auftritt.5,7
Es scheint noch weitere mögliche Risikofaktoren zu geben, die die Entstehung einer Depression begünstigen. Körperliche Erkrankungen (wie Krebs-, Herz-Kreislauf- und Demenz-Erkrankungen oder eine Schilddrüsenunterfunktion) sowie chronische Schmerzen können eine Depression auslösen. Auch Cannabis-Konsum und Alkohol-Missbrauch werden in diesem Zusammenhang genannt. Zudem reagieren manche Menschen auf Lichtmangel in den dunklen Herbst- und Wintermonaten mit einer Depression.5,7
Auswirkungen von Depressionen
Schwere Depressionen können verheerende Folgen haben – nicht nur für Patienten und ihre Angehörigen, sondern auch unter gesundheitsökonomischen Gesichtspunkten. So betrachtet die WHO Depressionen aktuell als eine der wichtigsten Volkskrankheiten und prognostiziert, dass der Stellenwert der Erkrankung in den kommenden Jahren noch weiter zunimmt. Die Organisation geht davon aus, dass unipolare Depressionen bis zum Jahr 2030 sogar die größte Bedeutung unter den Erkrankungen mit lebensverkürzenden bzw. einschränkenden Effekten haben werden.8
Im Hinblick auf den sozioökonomischen Status scheinen eine höhere Bildung und eine sichere berufliche Situation mit einer geringeren Häufigkeit von Depressionen einherzugehen, während Menschen mit niedrigem Bildungsniveau und Einkommen ein höheres Risiko für depressive Erkrankungen aufweisen.8
Als Maßeinheit wird dazu der sogenannte DALYs (Disability-adjusted Life Years) zugrunde gelegt: Er beschreibt die Lebensjahre, die durch Behinderung oder durch vorzeitiges Versterben infolge einer Krankheit verloren gehen. Bezogen auf diesen Indikator schätzt die WHO, das die stärksten Verluste an Lebensjahren für das Jahr 2030 durch unipolare Depressionen verursacht werden – damit läge die Erkrankung sogar noch vor Volkskrankheiten wie gefäßbedingten Herzerkrankungen und der Zuckerkrankheit, Diabetes mellitus.8
Auch für das Gesundheitssystem sind Depressionen sehr bedeutsam, da sie mit hohen Kosten einhergehen. Das Wesen der Erkrankung, die unter anderem mit Antriebsschwäche, mangelnder Konzentrationsfähigkeit und Kognitionsprobleme einhergeht, schränkt die Arbeitsfähigkeit vielfach ein.1 Untersuchungen zeigen, dass Arbeitnehmer mit Depressionen nahezu viermal mehr Krankheitstage aufweisen, gegenüber Angestellten ohne die Erkrankung.8
Depressionen sind noch immer mit einem besonderen Stigma behaftet, das sowohl den sozialen Kontext als auch die Arbeitswelt berührt. So stellen Arbeitgeber aufgrund von Vorurteilen gegenüber der Erkrankung seltener Mitarbeiter mit Depressionen als Menschen mit anderen chronischen Erkrankungen (z. B. Diabetes mellitus) ein.8
Die Ursache für diese Fehleinschätzungen liegen in fehlender Aufklärung und mangelndem Wissen um die Erkrankung. Betroffene leiden somit nicht nur unter der Erkrankung selbst, sondern zusätzlich unter ihrer Stigmatisierung.9
Dabei nimmt die Reaktion des sozialen Umfelds direkten Einfluss auf den Erkrankten und verschlechtert seine Situation oftmals weiter, denn Abwertung und Distanzierung fördern zusätzlich den sozialen Rückzug und verstärken Gefühle von Einsamkeit, Hoffnungslosigkeit und Schuld. Nicht zuletzt kann ein solcher Rückzug auch dazu führen, dass betroffene den Gang zum Arzt meiden und die Depression erst verzögert erkannt und behandelt wird.9
Die Belastung von Depressionen für Angehörige13
Die sozialen Beziehungen etwa Partner, Kinder und enge Freunde von Menschen, die an Depressionen leiden, sind durch die Erkrankung häufig stark belastet. Oft machen die engsten Angehörigen sich große Sorgen um den Betroffenen, fühlen sich zugleich jedoch hilf- und perspektivlos. Wenn Angehörige beim Umgang mit der Erkrankung frustriert, erschöpft oder überlastet werden, können oft Ärger und Wut hinzukommen, was die Betroffenen zusätzlich belastet.
Folgende Verhaltensregeln können im Umgang mit einem depressiven Angehörigen hilfreich sein:
- Depression als Erkrankung akzeptieren
- auf einen respektvollen Umgang achten
- Betroffene ermuntern, sich helfen zu lassen, zum Arztbesuch zu motivieren und ggf. zu begleiten
- geduldig sein, Aufmerksamkeit schenken
- Betroffene bei einer guten Tagestruktur unterstützen (z. B. feste gemeinsame Essenszeiten oder Aktivitäten wie Spaziergänge, Termine für soziale Aktivitäten)
- Verständnis für die negativen Gedanken des Erkrankten zeigen, auch wenn diese für die Angehörigen möglicherweise grundlos erscheinen
- körperliche Beschwerden des Betroffenen ernst nehmen und nicht als übertrieben oder gar eingebildet abtun
- auf sich selbst achten, eigene Grenzen respektieren, soziale Beziehungen weiterhin pflegen
- mit gutgemeinten Ratschlägen zurückhaltend sein
- den Erkrankten unterstützen, wenn er Eigeninitiative zeigt
Symptomatische Anzeichen der Verschlimmerung einer Depression
Während zunehmendes Interesse an Aktivitäten und sozialen Kontakten oder vielleicht wiederkehrende Freude an früheren Hobbies Anzeichen einer Besserung der Depression sein können, gibt es auch Frühzeichen, die eine Verschlechterung oder Wiederkehr der Erkrankung ankündigen. Dazu gehören:11
- zunehmende Müdigkeit und Erschöpfung
- vermehrte körperliche Beschwerden (z. B. Kopf- oder Rückenschmerzen, Druck auf der Brust)
- sozialer Rückzug
- Probleme morgens aus dem Bett zu kommen
- Ein- oder Durchschlafschwierigkeiten
- vermehrte Gereiztheit oder Nervosität
- Konzentrationsprobleme
- häufiges Grübeln
- geringerer (oder auch gesteigerter) Appetit
Depressionen können im Krankheitsverlauf auch von Suizidgedanken oder konkreten Suizidabsichten begleitet sein. Auf folgende Warnzeichen sollten Angehörige und Freunde von Menschen mit Depressionen besonders achten:12
- jede Andeutung von Selbstmordgedanken oder eine konkrete Androhung ernst nehmen
- auf Äußerungen der Hoffnungslosigkeit achten, wie „es hat keinen Sinn mehr“, „so will ich nicht mehr weitermachen …“
- auffällige Verhaltensänderung: der Betroffene wirkt auf einmal ruhiger oder gefestigter, nimmt Kontakt zu Freunden und Verwandten auf um sich zu verabschieden, regelt Erbschaftsangelegenheiten oder verschenkt Wertgegenstände
Besteht der Verdacht, dass ein Freund oder Angehöriger Suizidgedanken hegt, sollte er unbedingt offen darauf angesprochen werden. Zugleich gilt es, zeitnah professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen!
Referenzen
[1]: DGPPN (Hrsg.): S3-Leitlinie/Nationale VersorgungsLeitlinie Unipolare Depresssion, Kurzfassung, Version 1, 2. Auflage, 2017, AWMF-Register-Nr.: nvl-005. https://www.dgppn.de/_Resources/Persistent/d53e5967ade4134e444e71973752e10bcaebda79/S3-NVL_depression-2aufl-vers1-kurz.pdf. Letzter Zugriff: April 2025.
[2]: Gesundheitsinformation.de: Formen der Depression. https://www.gesundheitsinformation.de/formen-der-depression.html. Letzter Zugriff: April 2025.
[3]: Neurologen und Psychiater im Netz: Verlauf, Prognose und Heilungschancen bei depressiven Erkrankungen. https://www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org/psychiatrie-psychosomatik-psychotherapie/stoerungen-erkrankungen/depressionen/verlauf-prognose. Letzter Zugriff: April 2025.
[4]: Neurologen und Psychiater im Netz: Auswirkungen und Folgen einer Depression. https://www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org/psychiatrie-psychosomatik-psychotherapie/stoerungen-erkrankungen/depressionen/auswirkungen. Letzter Zugriff: April 2025.
[5]: Neurologen und Psychiater im Netz: Ursachen einer Depression. https://www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org/psychiatrie-psychosomatik-psychotherapie/stoerungen-erkrankungen/depressionen/ursachen. Letzter Zugriff: April 2025.
[6]: Gesundheitsinformation.de: Wie wirksam sind Antidepressiva? https://www.gesundheitsinformation.de/wie-wirksam-sind-antidepressiva.html. Letzter Zugriff: April 2025.
[7]: Gesundheitsinformation.de: Depression: Ursachen und Risikofaktoren. https://www.gesundheitsinformation.de/depression.html#Ursachen-und-Risikofaktoren. Letzter Zugriff: April 2025.
[8]: S3-Leitlinie/Nationale Versorgungsleitlinie Unipolare Depression Langfassung, Version 3.2, 2023, AWMF-Register-Nr.: nvl-005. https://register.awmf.org/assets/guidelines/nvl-005l_S3_Unipolare-Depression_2023-07.pdf. Letzter Zugriff: April 2025.
[9]: Stiftung Gesundheitswissen: Selbst schuld? Stigmatisierung von Krankheiten. 2019. https://www.stiftung-gesundheitswissen.de/gesundes-leben/psyche-wohlbefinden/diskriminierung. Letzter Zugriff: April 2025.
[10]: Stiftung Deutsche Depressionshilfe: Rat für Angehörige Depression. https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und-hilfe/rat-fuer-angehoerige. Letzter Zugriff: April 2025.
[11]: Stiftung Deutsche Depressionshilfe: Rückfallprophylaxe. https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und-hilfe/behandlung/rueckfallprophylaxe. Letzter Zugriff: April 2025.
[12]: Stiftung Deutsche Depressionshilfe: Suizidalität. https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und-hilfe/depression-in-verschiedenen-facetten/suizidalitaet. Letzter Zugriff: April 2025.